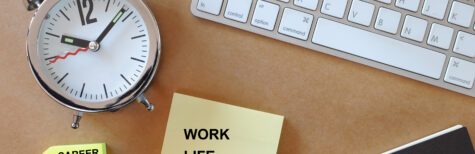Viertagewoche in der Praxis: So setzen Sie moderne Arbeitszeitmodelle rechtssicher um
Die Diskussion um die Viertagewoche nimmt in Deutschland Fahrt auf. Gerade im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte rückt das Thema Arbeitszeitflexibilisierung immer stärker in den Fokus. Immer mehr Unternehmen prüfen deshalb, wie sich eine Viertagewoche konkret in den eigenen Betriebsalltag integrieren lässt – ohne Produktivitätseinbußen oder rechtliche Risiken. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Modelle möglich sind, wo Fallstricke liegen und wie Sie das Arbeitszeitgesetz einhalten.
Zuletzt aktualisiert am: 21. November 2025

Der Trend zur verkürzten Arbeitswoche
Laut einer internationalen Studie von Randstad wünscht sich rund ein Drittel der Beschäftigten weltweit eine Vollzeitstelle mit einer kürzeren Arbeitswoche. Gründe dafür sind u.a.:
- Mehr Freizeit und Zeit für Familie
- Bessere Work-Life-Balance
- Höhere Motivation und Produktivität
Zugleich steigt der Druck auf Arbeitgeber, attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen, um als moderner Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Die Viertagewoche kann hier ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein – vorausgesetzt, sie ist rechtssicher und wirtschaftlich durchdacht umgesetzt.
Drei Modelle für die Viertagewoche im Überblick
Es gibt keine gesetzliche Definition der Viertagewoche. Unternehmen haben Spielraum, die Arbeitszeitgestaltung individuell zu regeln – im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG). Drei Varianten sind derzeit besonders relevant:
♦ Modell 1: Gleiche Wochenarbeitszeit, verteilt auf vier Tage
Bei diesem Modell bleiben Arbeitszeit und Gehalt unverändert. Die wöchentliche Arbeitszeit wird lediglich auf vier statt fünf Arbeitstage aufgeteilt. Beispiel: Statt 5 x 8 Stunden wird nun an 4 Tagen jeweils 10 Stunden gearbeitet.
Zu beachten:
- Laut § 3 ArbZG sind maximal 10 Stunden täglich zulässig – im Schnitt von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen jedoch nur 8 Stunden pro Werktag (Montag bis Samstag).
- Eine regelmäßige 10-Stunden-Taktung ist damit nur zulässig, wenn an anderen Tagen entsprechend weniger gearbeitet wird.
- Überstunden sind an einem bereits voll ausgereizten 10-Stunden-Tag nicht mehr erlaubt – auch nicht freiwillig.
Fazit: Dieses Modell erfordert sorgfältige Planung und rechtliche Prüfung, insbesondere bei der Erstellung von Dienstplänen und Arbeitszeitnachweisen.
♦ Modell 2: Reduzierte Arbeitszeit bei entsprechend reduziertem Gehalt
Hierbei handelt es sich rechtlich um Teilzeitbeschäftigung. Der oder die Mitarbeitende arbeitet z. B. 32 statt 40 Stunden pro Woche und erhält im Gegenzug nur 80 % des vorherigen Gehalts.
Wichtig:
- Teilzeit darf nicht einseitig vom Arbeitgeber angeordnet werden.
- Es braucht eine schriftliche Vereinbarung.
- In Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten haben Arbeitnehmer einen Anspruch auf Teilzeit (§ 8 TzBfG), wenn keine betrieblichen Gründe dagegensprechen.
Vorteil: Rechtlich klar definiert und einfach umsetzbar – insbesondere für Unternehmen, die sich eine echte Arbeitszeitverkürzung auch wirtschaftlich leisten können.
♦ Modell 3: Arbeitszeitreduzierung bei vollem Gehalt
Die umstrittenste und zugleich attraktivste Variante: Verringerung der Arbeitszeit bei gleichbleibendem Lohn – z. B. von 40 auf 32 Stunden bei unverändertem Monatsgehalt.
Hintergrund: Unternehmen setzen auf gesteigerte Produktivität durch:
- Optimierte Prozesse
- Weniger Meetings
- Höhere Eigenverantwortung
- Bessere Erholung der Mitarbeitenden
Achtung: Diese Form muss vertragsrechtlich klar geregelt und betriebswirtschaftlich tragfähig sein. Geeignet ist das Modell vor allem für Unternehmen mit hoher Eigenmotivation im Team und messbaren Output-Zielen.
Rechtliche Rahmenbedingungen
Unabhängig vom Modell müssen Sie folgende Punkte beachten:
- Höchstarbeitszeit (§ 3 ArbZG): max. 10 Std. pro Tag bei Durchschnittsgrenze von 8 Std. über 6 Monate
- Ruhepausen (§ 4 ArbZG): mind. 30 Minuten bei >6 Std., 45 Minuten bei >9 Std. Arbeit
- Ruhezeit (§ 5 ArbZG): mind. 11 Stunden ununterbrochen zwischen zwei Arbeitstagen
- Schriftform bei Vertragsänderungen (§ 2 NachwG)
Chancen und Risiken für Unternehmen
− Höhere Arbeitgeberattraktivität – v.a. für junge Talente und Familien
− Gesteigerte Motivation und Leistungsbereitschaft
− Reduzierte Fehlzeiten durch bessere Work-Life-Balance
+ Höhere Belastung an einzelnen Arbeitstagen – insbesondere bei unveränderter Wochenarbeitszeit
+ Komplexere Einsatzplanung – besonders bei Teilzeitkräften oder Kundenbetrieb mit festen Öffnungszeiten
+ Erhöhte Kostenrisiken, wenn Gehalt gleich bleibt, aber weniger Stunden gearbeitet werden
Fazit: Gut geplant ist halb gewonnen
Die Viertagewoche kann eine echte Chance für Arbeitgeber sein – wenn Sie das passende Modell wählen und die Umsetzung rechtssicher gestalten. Achten Sie darauf, sowohl arbeitsrechtliche als auch wirtschaftliche Aspekte sorgfältig zu prüfen.
Tipp: Klären Sie frühzeitig mit Ihrem HR-Team, Ihrer Rechtsabteilung oder externen Beratern, welches Modell für Ihren Betrieb am besten geeignet ist.