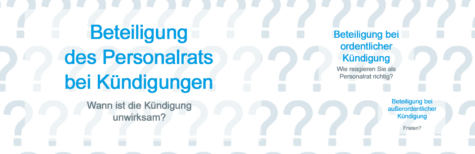Rechte und Pflichten kranker Kollegen
Die Hausbesuche bei kranken Tesla-Beschäftigten haben das Thema Arbeitsunfähigkeit wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Was darf der Arbeitgeber kontrollieren und wie müssen sich Mitarbeiter im Krankheitsfall verhalten?
Zuletzt aktualisiert am: 18. Juni 2025
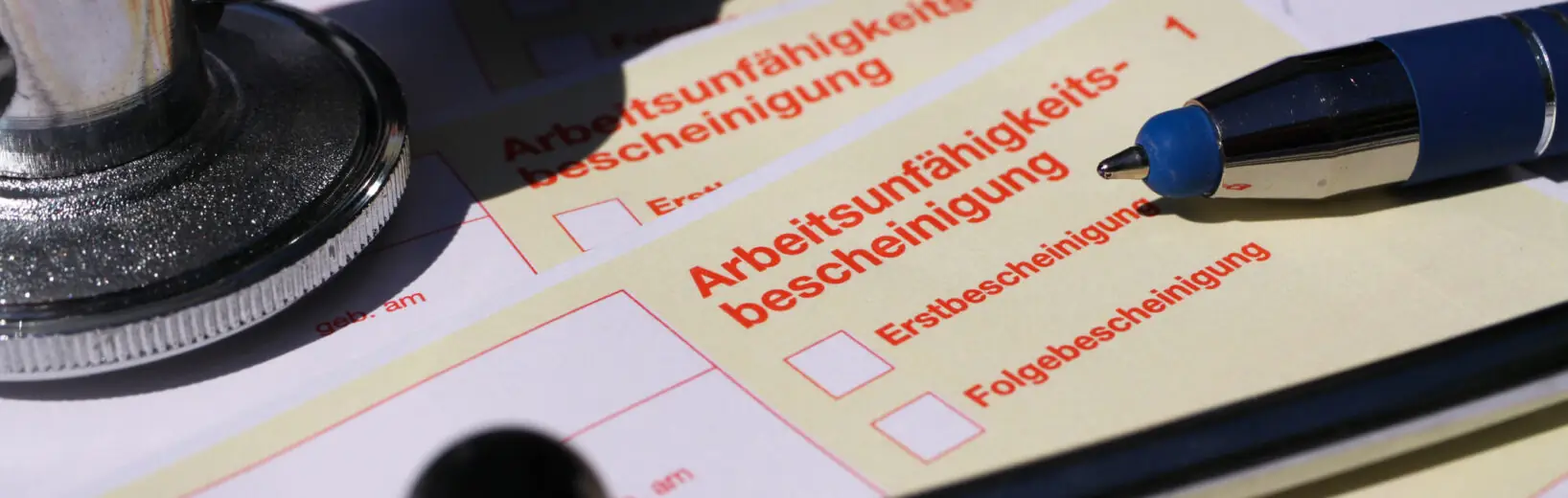
Rechtliche Fragen rund um krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit betreffen meist das Individualarbeitsrecht und sind daher dem Mitbestimmungsbereich des Betriebsrats entzogen. Allerdings können je nach Sachverhalt auch erzwingbare Mitbestimmungsrechte (insbesondere nach § 87 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 6 und Nr. 7 BetrVG) einschlägig sein. Zudem ist der Abschluss einer freiwilligen Betriebsvereinbarung denkbar, die Fragen rund um die Krankschreibung und die Rechte und Pflichten der Betriebsparteien in diesem Zusammenhang regelt. Diese Vereinbarung beruht allerdings weitgehend auf dem Verhandlungsgeschick des Gremiums – erzwingbar dürfte sie in aller Regel nicht sein. Trotz eingeschränkter Möglichkeiten zur Mitbestimmung ist es sinnvoll, dass der Betriebsrat die rechtlichen Grundzüge kennt.
EXPERTENTIPP
Gibt es im Betrieb Konflikte in Sachen Fehlzeiten, kann der Betriebsrat in erster Linie Ansprechpartner für die Beschäftigten sein. Erfährt er von etwaigen Missständen, sollte er das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen und Abhilfe schaffen. Generell kann er hier auch als Vermittler auftreten.
Pflichten der Arbeitnehmer während der Krankschreibung hängen vom Einzelfall ab
Die Vorstellung, dass Beschäftigte während ihrer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit nur zu Hause bleiben müssen und praktisch nichts unternehmen dürfen, ist ebenso weit verbreitet wie falsch. Mit einer Krankschreibung stellt ein Arzt fest, dass der Beschäftigte wegen der Arbeitsunfähigkeit von der Pflicht zur Arbeitsleistung befreit ist. Sie bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Beschäftigte zum Nichtstun verdammt ist. Was der kranke Arbeitnehmer darf oder nicht, hängt vielmehr von seiner Krankheit ab. Es kommt darauf an, welches Verhalten des Beschäftigten seiner Genesung schaden könnten. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, alles zu unterlassen, was der Genesung schadet. Er muss den Anweisungen des behandelnden Arztes folgen.
Was versteht man unter genesungswidrigem Verhalten?
Genesungswidriges Verhalten kann alles sein, was den Heilungsprozess behindern oder verzögern kann. Was das ist, hängt jeweils vom Einzelfall ab: Ein Dachdecker mit Rückenbeschwerden darf während seiner Krankschreibung etwa keine schweren Gartenarbeiten verrichten. Einkaufen, spazieren oder ins Restaurant gehen, ist ihm erlaubt. Für Menschen mit einer psychischen Erkrankung kann es sich auf die Genesung sogar sehr positiv auswirken, soziale Kontakte außerhalb der Wohnung zu pflegen. Handelt es sich um Erkältungskrankheiten, kann ein Spaziergang an der frischen Luft hilfreich sein.
PRAXISTIPP
Grundsätzlich sollten Betriebsräte den Kollegen ans Herz legen, sich im Zweifel lieber zu vorsichtig zu verhalten. Ratsam ist es für Arbeitnehmer in jedem Fall, sich bei einer Krankschreibung über die Diagnose vom Arzt informieren zu lassen und dessen Behandlungsempfehlungen zu befolgen.
Arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung drohen
Verhält sich der Beschäftigte während seiner Krankschreibung genesungswidrig, kann dies ernsthafte Konsequenzen haben. Damit gefährdet der Betroffene nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch seinen Arbeitsplatz. In der Regel dürfte hier eine nachgewiesene Pflichtverletzung des Arbeitnehmers im Hinblick auf seine Genesung zumindest den Ausspruch einer Abmahnung durch den Arbeitgeber rechtfertigen. Ob ohne Abmahnung sofort eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen werden kann, hängt vom Einzelfall ab, dürfte aber eher die Ausnahme sein.
Arbeit für andere Arbeitgeber kann fristlose Entlassung rechtfertigen
Eine solche Ausnahme ist z. B. dann gegeben, wenn der Beschäftigte während der Krankschreibung für einen anderen Arbeitgeber tätig ist. In diesem Fall ist das Vertrauensverhältnis so massiv gestört, dass der Arbeitgeber außerordentlich kündigen darf – ohne vorher abzumahnen.
Reisen während der Arbeitsunfähigkeit
Nicht so eindeutig sind Situationen, in denen Beschäftigte während der Krankschreibung verreisen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Reisen nicht immer verboten sind. Wenn sie entweder medizinisch begründet sind oder die Genesung nicht beeinträchtigen, können sie durchaus erlaubt sein. Es ist allerdings auch bei erlaubten Reisen hilfreich, dies nur nach Absprache mit dem behandelnden Arzt zu tun. Weiterhin sollten Beschäftigte den Arbeitgeber über die Reisepläne informieren, um Missverständnisse gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Fristlose Kündigung beim „Blaumachen“?
Noch härter als beim genesungswidrigen Verhalten können die Sanktionen bei einer vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit sein. Dann kann schnell eine außerordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber im Raum stehen. Allerdings hat er das „Blaumachen“ zu beweisen. Zudem muss die Kündigung verhältnismäßig sein. Wenn auch eine Abmahnung reicht, um das Fehlverhalten zu sanktionieren, muss diese als milderes Mittel gewählt werden. Will der Arbeitgeber kündigen, muss er das innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis des Kündigungsgrunds tun (§ 626 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB).
Darf der Arbeitgeber Hausbesuche bei erkrankten Beschäftigten machen?
Grundsätzlich hat ein ärztliches Attest stets einen hohen Beweiswert. Das heißt, der Arbeitgeber sollte und muss zunächst darauf vertrauen, dass krankgeschriebene Arbeitnehmer tatsächlich arbeitsunfähig sind. Hausbesuche durch den Arbeitgeber sind allerdings auch nicht verboten. Sie haben nur hohe Hürden. So sind unangekündigte Hausbesuche – und damit ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Mitarbeiters – nur zulässig, wenn dabei datenschutzrechtliche Vorgaben beachtet werden. Danach muss sich der Arbeitgeber auf einen im konkreten Fall, objektiv belegbaren Verdacht berufen können, dass der Beschäftigte in Wirklichkeit gar nicht krank ist. Übrigens ist der Arbeitnehmer nicht verpflichtet, bei einem (unangekündigten) Hausbesuch die Tür zu öffnen oder einen Vertreter des Arbeitgebers hereinzubitten. Sogar ein Gespräch darf der Beschäftigte verweigern. Insbesondere ist er in keinster Weise verpflichtet, dem Arbeitgeber Details über seinen Gesundheitszustand mitzuteilen – weder bei einem persönlichen Treffen noch bei einem Telefonat. In seiner Privatsphäre ist der Beschäftigte hier maximal schützenswert.
EXPERTENTIPP
Bei einem konkreten Verdacht auf eine vorgetäuschte Krankheit darf der Arbeitgeber Schritte unternehmen, um das Verhalten des Beschäftigten zu kontrollieren. Überwacht der Arbeitgeber hingegen Arbeitnehmer aufgrund eines „Bauchgefühls“, vielleicht sogar durch Privatdetektive, ist diese eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Mitarbeiters. Dies kann dazu führen, dass der zu Unrecht überwachte Beschäftigte Schmerzensgeld vom Arbeitgeber fordern kann.
Bei Zweifeln: Kein Lohn oder Überprüfung durch Medizinischen Dienst
Hat der Arbeitgeber tatsächlich konkrete Anhaltspunkte, um an der Krankheit zu zweifeln, sollte er statt auf Kontrollbesuche auf effektivere Maßnahmen setzen: So kann er unter Umständen die Lohnfortzahlung aussetzen. Dann muss der Arbeitnehmer konkret begründen, welche Krankheit bestanden und die Arbeitsunfähigkeit begründet hat. Der Arbeitgeber darf auch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen beauftragen. Dieser kann herausfinden, ob Arbeitnehmer die Arbeitsunfähigkeit nur vortäuschen. Vorteil für den Arbeitgeber ist, dass die Krankenkasse den Grund der Arbeitsunfähigkeit kennt – im Gegensatz zum Arbeitgeber. Somit kann deren Medizinischer Dienst die Situation besser beurteilen.
HINWEIS
Das Ergebnis der Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen wird zunächst nur dem behandelnden Arzt mitgeteilt. Der Arbeitgeber bekommt lediglich dann eine Nachricht, wenn die Einschätzung des Medizinischen Diensts von der des Arztes abweicht.
Indizien für Überprüfung
Wann der Arbeitgeber den Medizinischen Dienst mit der Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit beauftragen darf, hängt letztlich natürlich immer von den genauen Umständen des Einzelfalls ab. Als Faustregel lässt sich aber sagen, dass ein ausreichender Verdacht vorliegt, wenn etwa ein Arbeitnehmer auffallend häufig oder immer wieder für kurze Zeit arbeitsunfähig ist. Außerdem sind Zweifel berechtigt, wenn solche Fehlzeiten häufig auf einen Montag oder Freitag fallen oder an solchen Tagen beginnen.