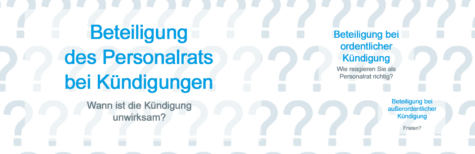Internetsurfen oder überlange Kaffeepausen während der Arbeitszeit – Arbeitszeitbetrug
Vertraglich festgelegte Arbeitszeiten schützen nicht davor, dass Arbeitnehmende ihre Arbeitszeit alternativ nutzen und damit sich des Arbeitszeitbetrugs schuldig machen. Beispiele sind unter anderem: Der Gang ins Fitnessstudio während der Arbeitszeit, private Erledigungen oder eine extralange Raucherpause. Arbeitnehmer unterschätzen meist, wie ernsthaft die rechtlichen Konsequenzen sein können; denn für Arbeitgeber kann Arbeitszeitbetrug zu Produktivitätsverlusten und Vertrauensschäden führen.
Zuletzt aktualisiert am: 21. Juli 2025

Formen des Arbeitszeitbetrugs
Der Arbeitszeitbetrug besagt, dass ein Arbeitnehmer bezahlt wird, ohne die vertraglich vereinbarte Arbeitsleistung zu erbringen. In der Praxis gibt es unterschiedliche Formen, wie Mitarbeitende ihren Arbeitgeber bei der Arbeitszeit „hintergehen“ können:
Zu spätes Kommen oder vorzeitiges Gehen: Der Mitarbeiter erscheint systematisch zu spät am Arbeitsplatz oder verlässt ihn früher, ohne dies als Freizeit zu deklarieren. Die nicht geleistete Zeit wird trotzdem wie volle Arbeitszeit vergütet. Fehlerhaftes Ein- und Ausstempeln oder Manipulation der Zeiterfassung: Hierunter fällt das Einchecken in ein Stechuhr- oder Chipkartensystem bei Abwesenheit des Mitarbeiters, d.h., er oder sie taucht nicht am Arbeitsplatz auf. Auch gibt es Fälle des „Buddy-Punching“, d.h., dass Kollegen gebeten werden, für andere ein- oder auszustempeln. Zudem fällt nachträgliches Verfälschen digitaler Zeiterfassungen in diese Kategorie. Extreme Fälle des Arbeitszeitsbetrugs zeigen sich beim unentschuldigten Fehlen, etwa, wenn Arbeitnehmer komplette Arbeitstage fehlen, ohne Urlaub zu nehmen.
Überlange Pausen und private Handlungen
Verbreitet und oft nicht nachzuvollziehen sind überlange oder zusätzliche Pausen, die nicht im Zeitsystem erfasst sind. Ein häufiges Muster liegt vor, wenn Mitarbeitende ihre Pausenzeiten über die erlaubte Dauer ausdehnen oder zusätzliche Pausen einbauen, ohne diese als Freizeit zu verbuchen. Ein Beispiel dafür sind ausschweifende Raucherpausen, ohne auszustempeln.
Zudem sind private Aktivitäten während der Arbeitszeit ein häufiges Muster. Der Mitarbeiter ist zwar anwesend, nutzt die Arbeitszeit aber für Privates, wie Surfen im Internet, Schreiben privater E-Mails, für längere private Telefonate oder das Anschauen von Videos. Maßgeblich ist hier die Dauer: Solange diese Tätigkeiten nicht nur gelegentliche, kurze Unterbrechungen sind, sondern in beachtlichem Umfang in die Arbeitszeit fallen, handelt es sich um erschlichene bezahlte Freizeit und damit Arbeitszeitbetrug. Kleinere Ablenkungen im Arbeitsalltag – etwa hin und wieder ein kurzer Plausch unter Kollegen oder ein kurzer privater Anruf – werden in der Regel noch nicht als Betrug gewertet, solange kein Vorsatz zur Arbeitszeitverkürzung vorliegt. Entscheidend ist, dass bei einem echten Arbeitszeitbetrug planmäßig und in großem Umfang gegen die vertragliche Arbeitszeiterfüllung verstoßen wird.
Motive für Arbeitszeitbetrug
Die Motive sind vielfältig. So kann das Gefühl von Ungerechtigkeit oder Überlastung laut einer repräsentativen Befragung der Grund sein. Etwa ein Drittel der Arbeitnehmenden sehen ein Ungleichgewicht zwischen Leistung und Vergütung – etwa unbezahlte Überstunden – als einen Anlass, Arbeitszeit absichtlich falsch zu erfassen. Frustration und Motivationsprobleme oder einfach Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen oder dem Betriebsklima ist ein weiterer häufiger Grund für Arbeitszeitbetrug bei etwa 16 % der Befragten. Wer sich vom Arbeitgeber unfair behandelt oder wenig wertgeschätzt fühlt, verliert leichter die Hemmungen, an der Arbeitszeit zu drehen. Insbesondere bei innerer Kündigung neigen Mitarbeitende dazu, Dienst nach Vorschrift zu unterschreiten – das heißt, aktiv weniger zu arbeiten, als sie sollten. Hinzu kommen private Verpflichtungen und Ablenkungen: Rund 13 % der Beschäftigten nennen persönliche oder familiäre Verpflichtungen als Ursache für Arbeitszeitbetrug. Darunter fallen z.B. Mitarbeitende, die während der Arbeitszeit zum Arzt gehen, Behördengänge oder Einkäufe erledigen oder sich um Kinder kümmern. Ein ganz anderer Faktor ist die fehlende unmittelbare Kontrolle durch Vorgesetzte. Gerade im Homeoffice oder bei Vertrauensarbeitszeit fühlen sich manche unbeobachtet und lassen daher eher mal die Arbeit liegen. Während im Büro durchschnittlich schon 71 % der Beschäftigten gelegentlich private Dinge während der Arbeitszeit erledigen, liegt dieser Anteil im Homeoffice bei ganzen 82 %. Schließlich spielt Gruppendruck eine Rolle: Die Arbeitskultur kann ebenfalls ein Motiv liefern. Wenn im Team ein lockereres Verständnis von Arbeitszeit herrscht (z.B. alle kommen regelmäßig 5 Minuten zu spät ohne Konsequenz), kann das Nachahmer-Effekte auslösen.
Arbeitsrechtliche Konsequenzen
Für Arbeitnehmende ist Arbeitszeitbetrug ein Risiko. Wird ein solcher Verstoß entdeckt und nachgewiesen, drohen arbeitsrechtliche Sanktionen – im schlimmsten Fall fristlose Kündigung des Arbeitsvertrags. Arbeitgeber fassen derartige Pflichtverletzungen als schweren Vertrauensbruch auf, denn der Arbeitnehmer hat bewusst gegen seine Hauptleistungspflicht, die Arbeitsleistung in der vereinbarten Zeit, verstoßen. In einigen Fällen kann Arbeitszeitbetrug sogar als Straftat gewertet werden, da der Arbeitnehmer sich vorsätzlich Arbeitsentgelt für nicht geleistete Arbeit erschleicht. Dementsprechend urteilen die Gerichte: Die höchstrichterliche Rechtsprechung – insbesondere das Bundesarbeitsgericht (BAG) – sieht im vorsätzlichen Falschführen von Arbeitszeitkonten grundsätzlich einen wichtigen Grund für eine außerordentliche (fristlose) Kündigung gemäß § 626 BGB. Das heißt: Wurde die Arbeitszeit absichtlich falsch dokumentiert, ist die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für den Arbeitgeber unzumutbar – eine Kündigung ist an sich gerechtfertigt. Bei milderen Fällen kann es zur Abmahnung kommen: Stellt der Arbeitgeber fest, dass ein Arbeitnehmer in geringerem Umfang die Arbeitszeit verletzt hat – etwa ein einmaliges Überziehen der Pause um einige Minuten oder gelegentliches privates Surfen – wird in der Regel zunächst abgemahnt. Wiederholtes Fehlverhalten nach bereits erfolgter Abmahnung führt fast zwangsläufig zur Kündigung. Hat der Arbeitnehmer trotz Abmahnung erneut Arbeitszeitbetrug begangen, kann der Arbeitgeber ordentlich – und bei besonderer Schwere auch fristlos – kündigen.
Praxisbeispiele aus der Rechtsprechung
Ein Ticketkontrolleur im öffentlichen Nahverkehr erschlich sich innerhalb weniger Wochen rund 26 Stunden Arbeitszeit, in denen er private Termine wie Fitnessstudio- oder Friseurbesuche wahrnahm. Damit unterlief er seine Zeiterfassung in erheblichem Maße. Der Arbeitgeber schöpfte Verdacht und engagierte eine Detektei zur Observation. Als Ergebnis wurde der Kontrolleur fristlos entlassen. Das Arbeitsgericht Köln wertete sein Verhalten als schweren Vertrauensmissbrauch; die heimliche Kontrolle war in diesem Fall verhältnismäßig und datenschutzrechtlich zulässig, da ein konkreter Verdacht auf eine erhebliche Pflichtverletzung bestand. In einem BAG-Urteil von 2011 (Az. 2 AZR 381/10) ging es um eine langjährig beschäftigte Verwaltungsangestellte, die in Gleitzeit arbeitete. Sie stempelte bereits auf dem Parkplatz ein, bevor sie tatsächlich ihren Arbeitsplatz erreichte. Über eine längere Zeit summierten sich somit 135 Minuten als bezahlt erfasste, aber nicht geleistete Arbeitszeit. Obwohl die Mitarbeiterin 17 Jahre im Unternehmen war und ordentlich unkündbar schien, bestätigte das Bundesarbeitsgericht die fristlose Kündigung.