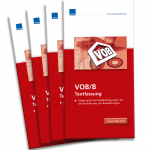§ 4 VOB/B Ausführung: Das sollten Sie über die Bauausführung wissen
Die Bauausführung ist eine wichtige Phase im Bauprozess. Wie die Ausführung nach § 4 VOB/B geregelt ist und was das für die Praxis bedeutet, erklären wir Ihnen hier.

Definition – Was ist die Bauausführung?
Die Bauausführung ist der praktische Teil eines Bauprojekts, bei dem die geplanten Arbeiten gemäß den Vorgaben und Plänen umgesetzt werden. Nach § 4 VOB/B beginnt sie mit dem Start der Arbeiten durch den Bauunternehmer und endet mit der Bauabnahme.
Während dieser Phase ist der Auftragnehmer für die ordnungsgemäße Umsetzung verantwortlich und gewährleistet die Einhaltung der vertraglichen Bedingungen und die Einhaltung der Regeln der Technik.
Der Auftraggeber hat das Recht, die Arbeiten zu überwachen und zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den vereinbarten Anforderungen entspricht und im vereinbarten Zeitplan umgesetzt wird.
Lesetipp: Die Aufgaben der Bauleitung vor, während und nach der Bauausführung, finden Sie im verlinkten Artikel.
So ist die Ausführung in § 4 VOB/B geregelt
Wollen Sie § 4 VOB/B im genauen Wortlaut nachlesen? Dann laden Sie sich kostenlos unsere digitale VOB/B-Textfassung herunter.
10 Tipps zur Bauausführung nach § 4 VOB/B
Damit bei der Bauausführung alles reibungslos verläuft, zeigen wir Ihnen gängige Fehler und wie Sie es besser machen können.
Tipp 1: Auftraggeber sind normalerweise für Genehmigungen verantwortlich
Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B ist normalerweise der Auftraggeber für die Beschaffung aller notwendigen Baugenehmigungen verantwortlich. Es gibt nur wenige Ausnahmen, bei denen dies vertraglich anders geregelt ist und der Auftragnehmer dafür zuständig ist.
Für Auftragnehmer: Wenn Ihnen die erforderlichen Genehmigungen für den Bau fehlen, bitten Sie Ihren Auftraggeber höflich darum, diese zu besorgen. Falls es Ihnen nicht möglich ist, ohne die Baugenehmigung zu starten, können Sie als letzten Ausweg eine Behinderungsanzeige einreichen.
Tipp 2: Auftraggeber sind an der Planung beteiligt
Der VOB/B-Vertrag sieht Mitwirkungspflichten an der Planung seitens des Auftraggebers vor (§ 3 Abs. 1 VOB/B) . Soll das Objekt laut Vertrag „schlüsselfertig“ oder „fix und fertig“ übergeben werden, sind Auftragnehmer stärker an der Planung beteiligt.
Für Auftragnehmer: Achten Sie als Auftragnehmer darauf, dass die Planungsverantwortung im Vertrag klar geregelt ist. In der Regel überlässt man die Planung dem Auftraggeber, um Risiken zu vermeiden. Übernehmen Sie Planungsaufgaben nur, wenn Sie über die entsprechenden Kompetenzen verfügen.
Tipp 3: Beide Parteien sollten Planbeistellfristen vereinbaren
Wenn der Auftraggeber die Planungsleistungen erbringt, sollten Planbeistellfristen vereinbart werden. Dabei legen beide Parteien fest, wann der Auftraggeber welche Pläne übergeben soll.
Solche Vereinbarungen schaffen Rechtssicherheit und verhindern Behinderungsanzeigen aufgrund fehlender Pläne. Davon profitierten Auftragnehmer ebenso wie Auftraggeber.
Tipp 4: Fristen für die Freigabe von Planungen einhalten
Übernimmt der Auftragnehmer Planungsleistungen, so wird regelmäßig die Freigabe der erstellten Planungsunterlagen durch den Auftraggeber vereinbart. Für eine bessere Planungssicherheit gibt es auch hier meist konkrete Fristen.
Für Auftragnehmer: Achten Sie darauf ausreichend Zeit für die Planungsleistungen zu vereinbaren, damit Sie nicht unter Druck geraten.
Tipp 5: Der Auftraggeber verantwortet eine fehlerfreie Planung
Der Planer ist in der Regel Erfüllungsgehilfe des Auftraggebers. Übernimmt der Auftraggeber die Planungsverpflichtung (§ 3 Abs. 1 VOB/B), ist er für eine fehlerfreie Planung verantwortlich.
Bei Planungsfehlern kann der Auftragnehmer verlangen, dass Mängelbeseitigungskosten geteilt werden. Der Auftragnehmer muss Baumängel erst beseitigen, wenn der Auftraggeber den entsprechenden Zuschuss oder eine Sicherheit leistet.
Tipp 6: Der Auftragnehmer haftet nur bei erkennbaren Fehlern
Auftraggeber denken oft, dass der Auftragnehmer für Planungsfehler haftet, wenn er nicht darauf hingewiesen hat. Aber das stimmt nicht immer. Der Auftragnehmer muss nur auf Planungsfehler hinweisen, die erkannt oder erkennbar sind. Nicht jeder Fehler ist für den Auftragnehmer erkennbar, wie beispielsweise ein versteckter Berechnungsfehler in der Statik.
Es gibt keine Automatik, die besagt, dass der Auftragnehmer immer haftet, wenn ein Planungsfehler auftritt. Es hängt vom Einzelfall ab, ob der Fehler für den Auftragnehmer erkennbar war. Ein Sachverständiger kann das oft klären, die Beweislast aber liegt beim Auftragnehmer.
Tipp 7: Der Auftragnehmer muss nur offensichtliche Fehler in der Ausschreibung bemerken
Der Auftragnehmer muss bei der Angebotserstellung nicht im Detail prüfen, ob das vom Auftraggeber ausgeschriebene Bauvorhaben technisch richtig oder machbar ist. Der Auftragnehmer muss lediglich überlegen, ob er die angebotenen Leistungen kalkulieren kann. Die technische Richtigkeit der Ausschreibung kann er in der kurzen Angebotsfrist oft nicht abschließend beurteilen.
Nur offensichtliche Fehler in der Ausschreibung müssen vom Auftragnehmer bemerkt werden, wie zum Beispiel eine unrealistisch geringe Bodenplattenstärke von 0,2 Millimeter.
Tipp 8: Auftragnehmer sollten das vereinbarte Material verbauen
Es steht jedem Bauherrn – mit Ausnahme des öffentlichen Auftraggebers – frei, ganz bestimmte Produkte auszuschreiben, ohne den Einbau eines gleichwertigen Produkts zu erlauben. In einem solchen Fall sollten Auftragnehmer nicht ohne Zustimmung des Auftraggebers vom ausgeschriebenen Produkt abweichen.
Für Auftragnehmer: Teils verlangen Auftraggeber zum Schein den Austausch eines gleichwertigen Produkts und bieten Ihnen dann eine finanzielle Lösung in Form einer Minderung an. Allerdings wird der Minderungsbetrag häufig so hoch angesetzt, dass er für Sie als Auftragnehmer nachteilig ist. Achten Sie daher von Anfang an darauf, das vereinbarte Material einzubauen.
Tipp 9: Auftragnehmer sollten Bedenken immer schriftlich anmelden
Es ist Pflicht des Auftragnehmers schriftlich Bedenken anzumelden, wenn
• die Planung des Auftraggebers mangelhaft ist.
• die Vorleistungen ungeeignet sind.
Dabei ist es wichtig, dass die Bedenkenanmeldung umfassend ist und der Auftraggeber ausdrücklich auf die drohenden Risiken hingewiesen wurde. Die Grundlage für die Bedenkenanmeldung liefern die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) der VOB/C. Diese enthält gewerkespezifische Vorgaben für die Normalausführung.
Für Auftragnehmer: Achten Sie darauf, dass Sie den Zugang der Bedenkenanmeldung beim Auftraggeber beweisen können. Wir empfehlen, entweder die Unterschrift des Auftraggebers unter die Bedenkenanmeldung setzen zu lassen oder das Dokument per Einschreiben zu verschicken.
Tipp 10: Der Auftraggeber kann eine Teilkündigung aussprechen
Ein Urteil vom Bundesgerichtshof vom 20.08.2009 (VII ZR 212/07) besagt, dass der Auftraggeber eine Kündigung auf einen Teil der Bauleistung beschränken kann, wenn nur bestimmte Leistungen mangelhaft sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine Teilkündigung nur bei klar abgrenzbaren Teilen der Leistung möglich ist, beispielsweise bei separaten Gebäuden.
Der Auftraggeber, der eine unzulässige Teilkündigung erklärt, begeht eine Vertragsverletzung. Der Auftragnehmer kann dann die Rücknahme der Teilkündigung verlangen und gegebenenfalls den gesamten Vertrag selbst kündigen. Es ist ratsam, in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Zulässigkeit von Teilkündigungen zu klären.
Auftragnehmer und -geber verantworten eine reibungslose Bauausführung nach § 4 VOB/B
Während der Phase der Bauausführung gibt es einiges zu beachten. In § 4 VOB/B wird dabei genau beschrieben, welche Rechte und Pflichten Auftraggeber und -nehmer während der Ausführung haben.
Hält der Auftragnehmer Anordnungen für unberechtigt oder unzweckmäßig, kann er schriftlich Bedenken anmelden. Kommt der Auftraggeber außerdem seinen Verpflichtungen – zum Beispiel dem Bereitstellen der erforderlichen Genehmigungen oder Pläne – nicht nach, kann der Auftragnehmer eine Behinderung anzeigen.
Weitere Erklärungen und Praxis-Tipps zur VOB finden Sie in unseren Produkten „BGB und VOB für Handwerker und Bauunternehmer“ sowie „BGB und VOB für Architekten, Ingenieure und Behörden“. Oder aber Sie laden sich unsere kostenlose Textfassung der VOB/B herunter.